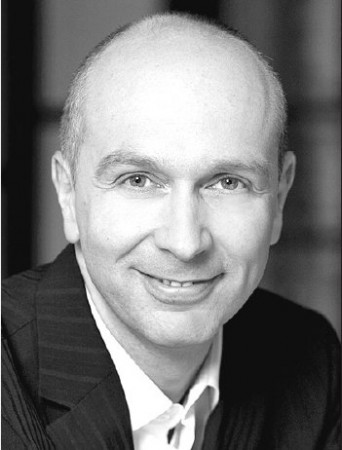In der Hauptstadt Berlin fällt auf zwölf Einpersonenhaushalte je eine Einzimmerwohnung. In den anderen Großstädten, die fast alle zwischen 50 und 55 Prozent Einpersonenhaushalte aufweisen, sehen die Zahlenverhältnisse etwas günstiger aus. Dieses grobe Missverhältnis wird aber nicht durch Neubauten verbessert, sondern im Gegenteil - es verschlechtert die Relation noch. Die Bauträger bauen bevorzugt große Wohnungen, da dies der Nachfrage der meistens als Eigennutzer auftretenden Investoren entspricht. Das bedeutet wiederum, dass einige gut situierte Einpersonenhaushalte in größeren Wohnungen leben oder es handelt sich um alleinstehende Mieter in preisgünstigen, zumeist öffentlich geförderten Mehrzimmerwohnungen.
Die große Mehrheit aber ist auf Wohngemeinschaften angewiesen, welches zumindest für berufstätige, erwachsene Personen in der Regel keine angemessene Wohnform ist. Auch sonst wird die Errichtung von Kleinwohnungen durch die verschiedenen bauordnungsrechtlichen Auflagen der kommunalen Behörden erschwert. Ein besonderes Ärgernis ist in dieser Hinsicht der Pkw-Stellplatznachweis. In innerörtlichen Großstadtlagen wird es sich dabei fast immer um Tiefgaragenplätze handeln. Da ein derartiger Tiefgaragenplatz in der Regel Kosten zwischen 25000 und 30000 Euro verursacht, wird eine rund 25 Quadratmeter große Kleinwohnung häufig um 25 bis 30 Prozent verteuert und damit erhöht sich im gleichen Umfang auch die Kostenmiete.
Unsinnige Vorschriften
In Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es, wie inzwischen in den meisten anderen Bundesländern auch, eine Förderung von Studentenwohnheimen, die überwiegend in Apartmentbauweise mit einer Wohnfläche von rund 20 Quadratmetern hergestellt werden. Die Landesbauordnung kennt jedoch die Nutzungsart Studentenwohnheim nicht. Infolgedessen verlangen viele Städte in NRW je Apartment einen Pkw-Stellplatz, was wiederum zur Unwirtschaftlichkeit der Baumaßnahmen führt. Generell müssen Stellplatzforderungen in der heutigen Zeit überdacht werden. Gerade Studenten oder andere junge Menschen verzichten häufig auf einen eigenen Pkw, da sie sich schlicht ein Auto nicht leisten können. In den Wohnheimen des FDS Gemeinnützige Stiftung hat eine Umfrage ergeben, dass nur noch jeder siebte Student über einen Pkw am Studienort verfügte.
Die beiden größten deutschen Städten Berlin und Hamburg haben den Pkw-Stellplatznachweis für Wohnraum aller Art gestrichen. Es gibt aber bedauerlicherweise auch noch andere Vorschriften die zu erheblichen Kostensteigerungen führen. So werden Abstellflächen für Fahrräder gefordert, die sich zu einem Großteil in geschlossenen Räumen befinden müssen und das sind dann in der Regel Kellerflächen, die zusätzlich zu errichten sind. Besonders kurios war die Forderung der Bauordnungsbehörde eines Berliner Bezirks. Dort sind für ein Studentenwohnheim mit 18 Quadratmeter großen Apartments jeweils zwei Quadratmeter Spielplatzfläche pro Einheit herzustellen. Kein Kind wird jemals ein derartiges Kleinapartment bewohnen und den Spielplatz benutzen.
In Bayern und Rheinland-Pfalz müssen für größere Studentenwohnheim-Projekte Planungswettbewerbe durchgeführt werden. Dies führt nicht zwingend zu einer kostenoptimierten Bauweise. Eher darf man annehmen, dass dadurch die Baukosten nach oben getrieben werden. Andere Bauordnungsbehörden übertreiben mit der Forderung, ein ganzes Wohngeschoß mit behindertengerechten Apartments für Rollstuhlfahrer herzustellen.
Dies führt dann dazu, dass bei einem viergeschossigen Baukörper wegen der größeren Apartmentflächen die Investitionskosten sich um rund 10 Prozent verteuern. An dieser Stelle sollten ebenfalls die mit erheblichen Mehrkosten verbundenen energetischen Auflagen Erwähnung finden. Ein Vergleich des Energieverbrauchs von Studentenwohnheimen, die 1980/1981 fertiggestellt wurden, mit Projekten die 2013 und 2014 übergeben wurden, wies bei gleicher Größe der Apartments und gleichartigem Verbrauchsverhalten der Bewohner keine nennenswerte Unterschiede im Energieverbrauch auf.
Wohnnebenkosten als zweite Miete
Generell haben sich die Wohnnebenkosten mittlerweile fast zu einer zweiten Miete entwickelt. Die Nebenkosten steigen heute deutlich dynamischer als die Mieten selbst. Die kommunalen Versorger nutzen ihre konkurrenzlose Marktstellung oft aus und verlangen überhöhte Gebühren. Ein besonderes Ärgernis ist in einigen Großstädten wie Berlin und Hamburg die Grundsteuer, welche dort fast einen Euro monatlich pro Quadratmeter Wohnfläche ausmacht. Wie unterschiedlich dies in deutschen Städten gehandhabt wird, zeigt der Vergleich der Städte Hamburg mit Würzburg. Die Grundsteuer in Hamburg ist fast sechsmal so hoch wie in Würzburg.
Unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang auch nicht die laufend erhöhte Grunderwerbssteuer bleiben, die in Deutschland nicht nur auf den Grunderwerb, sondern auch auf die noch zu erbringende gesamte Bauleistungen zu leisten ist. Wünschenswert wäre, um den Neubau von Mietwohnungen zu erleichtern, eine Reduzierung der Grunderwerbsteuer nur auf den reinen Grunderwerb. Auch sollte wieder zu einer bundeseinheitlichen Regelung hinsichtlich der Höhe der Grunderwerbsteuer zurückgekehrt werden. Im Moment schwanken die Sätze für die Grunderwerbsteuer, je nach Bundesland, zwischen 3,5 und 6,5 Prozent.
Derzeit plant die Bundesregierung die Abschreibungssätze für den Mietwohnungsbau auf 35 Prozent der Bau- und Baunebenkosten in den ersten drei Jahren zu erhöhen. Dies soll aber mit einem Zugeständnis der Bundesländer, die Grunderwerbsteuer einheitlich auf 3,5 Prozent zu ermäßigen, kombiniert werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Bundesrat in dieser Frage entscheidet. Die Investitionsbereitschaft in den Mietwohnungsbau würde durch eine derartige Reform erheblich gesteigert werden.
Die Mieter von Kleinwohnungen
Die Mieter im Marktsegment mit Wohnungen bis rund 60 Quadratmetern Wohnfläche sind überwiegend alleinstehende Personen. In den Groß- und Hochschulstädten werden es vielfach Studenten und Auszubildende sein, die kleine Apartments mit rund 20 Quadratmetern Wohnfläche mieten.
Insgesamt gibt es in Deutschland nur für knapp 10 Prozent der Studenten öffentlich geförderte Wohnheimplätze, die in der Regel von den Studierendenwerken und einigen wenigen gemeinnützigen Organisationen bewirtschaftet werden. In Berlin sind es nur 5 Prozent freifinanzierte, möblierte Apartments mit Warmmieten zwischen 430 und 600 Euro, diese können sich allerdings nur einkommensstarke Studenten beziehungsweise deren Eltern leisten.
Das verschärfte Mietrecht könnte zu einer Verknappung des Angebots an Wohnungen für Wohngemeinschaften führen, da es für den Vermieter einfacher und kostengünstiger ist an gut situierte konventionelle Mieter zu vermieten. Am Ende einer solchen Entwicklung würde dann eine Art "sozialer Numerus Clausus", wenigstens für die teuren Groß- und Universitätsstädte, stehen.
Noch ungünstiger stellt sich die Wohnsituation für Auszubildende dar. Ihnen stehen die geförderten Wohnheime in der Regel nicht offen. Lediglich Hamburg lässt auch Auszubildende in geförderten Heimen zu. Die durchschnittliche Ausbildungsvergütung beläuft sich derzeit auf 751 Euro brutto im 1. Ausbildungsjahr (2015). Dieser Betrag ist zwar steuerfrei, jedoch nicht unerheblich mit Sozialabgaben belastet. Netto verbleiben dem Auszubildenden rund 597 Euro. Bezieht man den Arbeitgeberanteil mit ein, so stehen einer Nettovergütung von knapp 600 Euro monatliche Sozialabgaben von 300 Euro gegenüber.
Selbst das soziale Musterland Schweden erhebt bei einem so niedrigen Einkommen, wenn es sich um junge Arbeitnehmer handelt, die nicht älter als 25 Jahre sind, nur rund 13 bis 14 Prozent vom Lohn als Abgaben und nicht, wie in Deutschland 40 Prozent. Das Kindergeld ist reine Glückssache. In vielen Fällen ist es fester Bestandteil des Familieneinkommens und steht dem Auszubildenden faktisch nicht zur Verfügung, denn wer wird schon seine Eltern auf Zahlung verklagen.
Ganz allgemein wird die mangelnde Mobilität von Auszubildenden beklagt und in der Tat bleiben gerade in der Großstadt viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Im Jahr 2014 überstieg die Zahl der Studienanfänger erstmals die der Auszubildenden im ersten Lehrjahr. Diese ungünstige Entwicklung wird jedoch nirgends hinterfragt. Die Ursachen hierfür mögen vor allem materieller Natur sein, denn nur eine kleine Minderheit der Ausbildungsbetriebe bezahlt Mietzuschüsse, wenn der Auszubildende nicht bei den Eltern wohnen kann. Es bedarf keiner näheren Erläuterung, dass man mit einem Einkommen von rund 600 Euro nicht 400 Euro für Miete und Nebenkosten aufbringen kann. Jeder Hartz-IV-Empfänger ist hier besser gestellt. Für viele potenzielle Auszubildende sind Langzeitpraktika und Aushilfsjobs durch den Mindestlohn von 8,50 Euro oftmals attraktiver als eine schlecht bezahlte Ausbildungsstelle.
Mehr Unterstützung für Auszubildende
Neben den zu geringen Einkünften ist die große Spreizung der Lehrlingsgehälter, je nach Ausbildung und Region (Ost/ West), ein großes Problem. Während die Vergütung eines Maurerlehrlings etwa bei 1000 Euro (Westdeutschland) liegt, muss eine Friseurin in Ostdeutschland mit etwa 270 Euro auskommen. Ein Mindestlohn für Auszubildende wäre hier eine Überlegung um der sehr ungleichen Vergütung entgegen zu wirken. Auch ist die gegenwärtige Förderung durch die Berufsausbildungsbeihilfe der Bundesagentur für Arbeit nicht auskömmlich. Gerade für Auszubildende in Großstädten reicht die gegenwärtig auf 250 Euro festgelegte Mietpauschale nicht aus, um den entsprechenden Wohnraum anzumieten. Auch diese Sätze sollten dringend den tatsächlichen Kostenbedingungen angepasst werden.
Der Auszubildende sollte mit der Erreichung des 18. Lebensjahrs allein bezugsberechtigt für das Kindergeld sein. Sozialabgaben sollten beim Arbeitnehmer erst ab einem Einkommen von 800 Euro monatlich anfallen. Eine Gegenfinanzierung könnte beispielsweise durch die gleichmäßige Besteuerung aller Einkunftsarten erfolgen. Die Begünstigung der Kapitaleinkünfte ist unsozial.
Auch könnte die Bundesagentur für Arbeit den Bau und Betrieb von Wohnheimen für Auszubildende finanzieren oder sich daran zumindest wesentlich beteiligen. Gerade im Hinblick auf die Integration und Ausbildung der vielen jungen Flüchtlinge wäre dies eine vordringliche Aufgabe. Bislang hat sie lediglich die Sanierung alter Lehrlingsheime des Kolpingwerks finanziert. Für neue Wohnheimprojekte wird keine kostendeckende Förderung angeboten.
Teure pädagogische Betreuungskonzepte sind in diesem Zusammenhang entbehrlich, denn das durchschnittliche Alter der Auszubildenden im 1. Jahr liegt heute bei 20 Jahren. Die Auszubildenden im 1. Jahr sind also deutlich älter als die Studienanfänger. Initiativen der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern wären ebenso wünschenswert wie Beteiligungen der Städte und Gemeinden an entsprechenden Aktionen. Mietzuschüsse der ausbildenden Unternehmen und ein bedarfsgerechtes Förderprogramm der Bundesagentur für Arbeit könnten auch einen wesentlichen Beitrag zur Eingliederung und Ausbildung junger Flüchtlinge leisten. Um einen Anreiz für Unternehmen und Auszubildende zu schaffen, sollten Mietzuschüsse jedoch steuer- und abgabenfrei sein. Gegenwärtig ist dies nicht der Fall.
Nachholbedarf beim altersgerechten Wohnen
Nur rund ein Prozent aller Wohnungen in Deutschland ist altengerecht ausgebaut, das heißt schwellenlos, mit einem hinreichend großen Aufzug und anderen Vorrichtungen, die für das altersgerechte Wohnen nötig sind. Die Nachfrage nach altengerechten Wohnungen ist jedoch riesengroß. Dem steht aber praktisch kein Angebot gegenüber. Der Markt für Eigentumswohnungen ist geprägt von hochpreisigen, großen Wohnungen.
Selbst Mietwohnungen werden kaum als Kleinwohnungen angeboten. Dafür sorgen schon die fehlgesteuerten Förderprogramme. Lediglich an Pflegeheimen sind häufig auch derartige altengerechte Wohnungen angegliedert. Eine gezielte Förderung dieser Wohnform könnte auch zu einer Entlastung der stark belegten Pflegeheime führen, da ein Ausbau der ambulanten Pflege den Einzug in ein Pflegeheim entbehrlich macht oder wenigstens verzögert. Ein derartiges Konzept müsste sich schon aus Kostengründen auf flächenoptimierte Grundrisse stützen. Ein- und Zweizimmerwohnungen in einer Größenordnung von 35 bis 60 Quadratmeter Wohnfläche könnten um einige größere Wohnungen ergänzt werden.
Nicht zu unterschätzen ist auch der Bedarf an Zweitwohnungen für Berufstätige, die Apartments entsprechend ihrer finanziellen Leistungskraft in einer Größenordnung zwischen 20 bis 35 Quadratmeter benötigen, häufig möbliert und hotelmäßig betrieben. Für diese Zielgruppe gibt es kaum ein erschwingliches Angebot auf dem Markt. Zwar bieten einige Hotelgruppen in den Großstädten aufwendig ausgestattete Apartments mit vollem Service an. Allerdings bezahlt man dann dafür auch 2000 Euro und mehr im Monat.
Dies können sich dann nur einige, wenige Führungskräfte leisten, auch wenn der Nutzer hierfür bis zu 1000 Euro monatlich vom zu versteuernden Einkommen absetzen kann, sofern er seinen Lebensmittelpunkt an einem anderen Ort hat. Für die große Mehrheit der Wochenendheimfahrer gibt es nur wenige und zudem unorganisierte Angebote. Abschließend lässt sich feststellen, dass der Bedarf an Kleinwohnungen und Unterstützung, sowohl für Studenten als auch Auszubildende und multilokal lebende Erwachsene, weiter wächst. Der öffentliche und mediale Fokus liegt jedoch oftmals nur auf der Förderung von Studenten. Es müssen jedoch dringendst für alle Personengruppen bezahlbare Wohnalternativen im Kleinwohnungsbereich geschaffen werden. Hierfür wäre eine verbesserte Förderung durch die öffentliche Hand sowie die Schaffung von investorenfreundlichen Anreizen, beispielsweise durch eine erhöhte steuerliche Abschreibung und durch die Reduzierung der Grunderwerbsteuer, wünschenswert.
Baukonzepte: Verkehrsanbindung für Zielgruppen wichtig
Die hier abgehandelten Zielgruppen Studenten, Auszubildende, Senioren und berufstätige "Zweitwohnungsnutzer" benötigen sämtliche, möglichst zentral oder zumindest nahverkehrlich gut angebundene Standorte. In der Umgebung gelegene Restaurants und Ladengeschäft wären wünschenswert. Hingegen können vergleichsweise laute Lagen, die für Familienwohnungen weniger infrage kommen, in Kauf genommen werden.
Das Planungskonzept baut auf ein Raster mit Kleinwohnungen in der Größenordnung zwischen 20 und 60 Quadratmeter Wohnfläche auf. Der Grundgedanke richtet sich auf eine Durchmischung aller vorgenannten Zielgruppen. Aufgabe des Investors muss auch in der sachgerechten Bewirtschaftung der Apartments bestehen. Dazu gehört beispielsweise die Vermittlung der erforderlichen Pflege- und Serviceleistungen. Wenn es bei der Verpflichtung der Wohnungsinvestoren bleibt, neben Eigentumswohnungen auch in einem bestimmten Umfang kostengünstige Mietwohnungen anzubieten, dann sollten dabei auch die vorgenannten Zielgruppen Berücksichtigung finden.
Insgesamt bedarf unsere Wohnungspolitik einerseits bundesweit einer größeren Vereinheitlichung. Andererseits sind neue, starke Impulse und die Entwicklung neuer wohnungspolitische Instrumente erforderlich, die viel stärker differenziert auf die verschiedenen Personengruppen abzustellen sind.
Teil 1 dieses Beitrags erschien in der Ausgabe 8/2016 der Immobilien & Finanzierung
Reiner Nittka Mitglied des Vorstands, GBI AG, Berlin