Sie befinden sich hier: Home › Kreditwesen › Themenschwerpunkte › Aufsätze › Der steinige Weg aus der expansiven Geldpolitik
Aufsätze
15.11.2016
Der steinige Weg aus der expansiven Geldpolitik
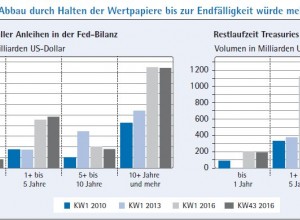
Abbildung 1: Passiver Abbau durch Halten der Wertpapiere bis zur Endfälligkeit würde mehr als zehn Jahre dauern Quelle: Macrobond

Dieser Artikel ist Teil unseres Online-Abo Angebots.