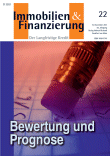Obwohl Rolf Gerlach seine Kandidatur für die bevorstehende Wahl des neuen Sparkassenpräsidenten zurückgezogen hat, wollte der Präsident des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe doch nicht darauf verzichten, seine für die Spitzenposition bereits formulierten Ziele dem Nachfolger von Heinrich Haasis mit auf den Weg zu geben. Ob sich der einzig verbliebene Bewerber für die Sparkassenspitze, Georg Fahrenschon, daran orientieren wird, hängt ganz wesentlich davon ab, ob die übrigen Teile der großen S-Finanzgruppe mit Gerlach einer Meinung sind. Zweifel sind angebracht. Denn dass er nicht mehr für diese Wahl zur Verfügung steht, begründete der Westfale mit dem mangelnden Willen relevanter Gremien, mit den Kandidaten über deren inhaltliche Prioritäten ihrer möglichen Präsidentschaft zu diskutieren. Möglich, dass sich innerhalb der Gruppe mehr Widerstand gegen Gerlach regte, als er selbst erwartet hätte. Möglich aber auch, dass die von Gerlach gesetzten Schwerpunkte in der Organisation nicht mehrheitsfähig sind.
Tatsächlich sind einige Punkte, mit denen er die Einheit der Sparkassen stärken will, herausfordernd. In einer Rede auf einem Kongress des IT-Dienstleisters Finanz Informatik beschwor er zwar einerseits die "Kraft der Dezentralität" als Stärke der Sparkassen und lehnte es ab, seine Hoffnungen in die höhere Einsicht einer Konzernleitung zu setzen. Andererseits soll gerade das bei den Dienstleistern und Verbundunternehmen der Sparkassen nicht gelten. Unter anderem sähe er die Landesbausparkassen gerne konsolidiert. Dadurch erwartet er Kosteneinsparungen von immerhin 300 Millionen Euro. Allerdings vermeidet er es, ins Detail zu gehen. Wie, bis wann und in welchen Bereichen eine "Konsolidierung" aussehen könnte, überlies er der Fantasie seiner Zuhörer.
Grundsätzlich ist der Gedanke einer Bündelung der Bausparkompetenz in der Sparkassenorganisation nicht neu. Bereits in der Vergangenheit haben die öffentlich-rechtlichen Bausparkassen bewiesen, dass sie es verstehen, Ressourcen zu bündeln und Unternehmen zu verschmelzen. Im Marketing tritt die LBS einheitlich auf. Bei der IT dominiert inzwischen ein System. In weiteren Bereichen werden Kooperationsmöglichkeiten ausprobiert. Allerdings setzt das Kartellrecht den Absprachen gewisse Grenzen, denn juristisch sind die Landesbausparkassen trotz Regionalitätsprinzip immer noch eigenständige Unternehmen.
Eine Konsolidierungsvariante wäre die Bildung einer gesamtdeutschen LBS. Erfahrungen mit Fusionen haben die Landesbausparkassen bereits sammeln können - zuletzt in Baden und Württemberg sowie in Hamburg und Schles-wig-Holstein. Dabei zeigte sich freilich, dass diese Prozesse Zeit, Geld und Arbeitsplätze kosten. Vor allem die Zusammenführung der Bausparkollektive stellt eine enorme Herausforderung dar, die schnelle Kosteneinsparungen nicht erwarten lässt. Es braucht also auch erheblichen (Durchhalte-)Willen.
Als weiteres Hindernis haben sich in der Vergangenheit die sehr unterschiedlichen Eigentümerstrukturen erwiesen. In Bayern, im Saarland sowie in Hessen und Thüringen sind die Landesbausparkassen Abteilungen der jeweiligen Landesbanken. In deren Augen stellen die Bausparkassen mit ihrem kleinteiligen, gut besicherten Baufinanzierungsgeschäft ein unter Regulierungs- und Risikoaspekten bedeutendes Asset dar. Doch auch bei den übrigen Landesbausparkassen ist noch zu klären, ob die lokalen Sparkassen ihre regionalen Bausparinstitute zugunsten einer Bundes-LBS aufgeben wollen. Denn sie würden maßgeblich an Einfluss verlieren. Ob und wann sich unter diesen Umständen die von Gerlach genannten Einsparungen tatsächlich realisieren lassen, ist deshalb fraglich. Es wären nicht die ersten und wohl auch nicht die letzten Ideen, die am Primat der Dezentralität des Verbundes scheitern. Überlegenswert sind die Vorschläge aber allemal. L. H.