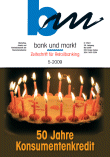Herr Dr. van Hooven, seit ihren Ursprüngen im Jahr 1870 hat die Deutsche Bank sich stets als eine deutsche Bank verstanden. Nun hat mit dem Schweizer Josef Ackermann zum ersten Mal ein Ausländer die Leitung des Instituts übernommen. Ist das aus Ihrer Sicht eine Zäsur?
Ich muss vorab eine grundsätzliche Anmerkung machen. Es fällt mir immer etwas schwer, mich über die Bank zu äußern, aus der ich vor einem Jahrzehnt mit dem Erreichen der Altersgrenze ausgeschieden bin. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft daran, welche zwiespältigen Empfindungen ich hatte, wenn ich in meiner aktiven Zeit als Vorstandsmitglied den Besuch von pensionierten Kollegen bekam, die mit der Frage "Was gibt's Neues?" in der Tür meines Büros standen. Wer wie ich nach zwei Jahrzehnten im Vorstand, nun nicht mehr an den Entscheidungsprozessen beteiligt ist, sollte Zurückhaltung üben. Das ist jedoch kein Ausdruck von Desinteresse. Die Entwicklung dieser Bank, in der ich mein ganzes Berufsleben verbracht habe, beschäftigt mich schon.
Mit welchem Ergebnis?
Mit einem intensiven Nachdenken darüber, ob diese Bank noch das ist, was sie nach ihrem Gründungsauftrag sein sollte, und wenn diese Frage zu verneinen ist, ob eine solche Entwicklung zu verantworten ist. Ich habe es begrüßt, dass sich der bisherige Vorstandssprecher und nunmehrige Aufsichtsratsvorsitzende Rolf Breuer dezidiert zu den deutschen Wurzeln und dem deutschen Standort der Bank bekannt hat. Beides sei, so hat er öffentlich erklärt, ein Wettbewerbsvorteil. Er hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass er weltweit kein Geldinstitut kenne, das international Bedeutung hat und nicht zugleich in seinem Heimatmarkt groß ist. Das ist eine Auffassung, der ich zustimmen kann. Ich meine, es ist notwendig, sich an die Ursprünge dieses Instituts im Vorfeld der Reichsgründung von 1871 zu erinnern. Damals ging es darum, eine Bank zur Finanzierung des rasch wachsenden Außenhandels zu schaffen, und dafür war eine breite Geschäftsgrundlage im Inland ganz unerlässlich. Also wurde, wie man in der einschlägigen Literatur nachlesen kann, noch im Gründungsjahr das Einlagengeschäft eingeführt, und zwar mit großem Erfolg. Bald darauf stieg man auch in die Industriefinanzierung ein, die Universalbank war geboren. Von diesen ersten Jahren nach der Gründung spannt sich doch ein Bogen bis in die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Wiederaufstieg der Deutschen Bank eng mit dem Wirtschaftswunder der jungen Bundesrepublik verbunden war und der "kleine Mann" als Kunde entdeckt wurde ...
Gert Fröbes "Otto Normalverbraucher", der nichts hatte, auch keine oder kaum Sicherheiten, der aber Geld brauchte ...
... der Kunde im Blaumann, der durch das Marmorportal kam und einen Kredit haben wollte, weil er sich etwas anschaffen wollte. Dieser Kreditnehmer erwies sich alles in allem als grundsolide. Aus den 200 000 Kunden der Deutschen Bank damals waren durch das Massengeschäft bis 1990 sechs Millionen Kunden geworden. Diese Zahlen sind ja nicht nur ein Ausdruck für geschäftlichen Er folg, sondern das waren sechs Millionen sehr individuelle Vertrauensbeweise. Sie beschreiben auch eine gesellschaftspolitische Dimension, und um die geht es mir. Wir haben uns damals sehr intensiv bemüht, und wie ich glaube, mit Erfolg, unsere Mitarbeiter entsprechend zu schulen, ihnen das Bewusstsein zu vermitteln, dass diese Kunden Menschen mit individuellen Problemen und Schicksalen sind. Ich würde es sehr bedauern, wenn dieses Potenzial verloren ginge, indem es einfach nicht mehr genutzt wird.
Sehen Sie diese Gefahr?
Ich möchte mich hier auf ein paar grundsätzliche Anmerkungen beschränken. Es ist meine Überzeugung, dass dieses Potenzial weiter entwickelt werden muss, und dass darin eine ganz wichtige Aufgabe für die Zukunftssicherung und den Geschäftserfolg der Deutschen Bank liegt. Es werden immer neue Finanzprodukte auf den Markt gebracht, und damit werden auch immer neue Wege zu dem Ziel eröffnet, das sich mit dem Slogan "Geld ist gedruckte Freiheit" definieren lässt. Diese Innovationen müssen an den Kunden gebracht werden. Das ist nicht nur eine Voraussetzung für den Geschäftserfolg, sondern auch für die Stabilität unseres demokratischen Systems, die vor allem auf dem eigenverantwortlichen Bürger mit einem vernünftigen materiellen Hintergrund beruht. Dieser Bürger bedarf der fairen, sachkundigen Beratung. Das ist eine der ganz essenziellen Aufgaben der Deutschen Bank, der Banken überhaupt.
Aber dann müssen Sie doch die Gründung der "Deutschen Bank 24" mit der Ausgliederung des Massengeschäfts als Schritt in die falsche Richtung empfunden haben?
Die Bank hat in den neunziger Jahren das Effektengeschäft, das früher eine mehr sekundäre Rolle gespielt hat, ganz in den Vordergrund gerückt und diese Strategie mit dem Begriff des "Shareholder-Value" verbunden, also das Aktionärsinteresse bedient. Das konnte man nur dann mit hohen Dividenden pflegen, wenn man ganz bestimmte, dem Aktienmarkt zuzuordnende Geschäfte machte. Das Privatkundengeschäft hingegen wurde sehr schnell primär unter Kostengesichtspunkten beurteilt. Das führte zu Schlussfolgerungen, denen wir damals begegnen wollten, indem wir versuchten, die teuerste Veranstaltung des Privatkundengeschäfts, den Zahlungsverkehr, zu beeinflussen.
In der Ausgliederung des Mengengeschäfts liegt doch die Abkehr vom Grundsatz der Universalbank. Ist das der eigentliche Grund Ihrer Besorgnis?
Es ging ja schon einmal sehr ernsthaft darum, ob man diesen Teil der Bankaktivitäten schlichtweg verkauft. Das hätte ich für einen schweren strategischen Fehler gehalten. Die Gründung der "Bank 24" hat sich ebenfalls als problematisch erwiesen, denn damit entstand der Eindruck, es gebe innerhalb der Deutschen Bank eine zweite Bank, und die Wahrnehmung vieler Kunden war, sie seien zweitrangig. Eine solche Situation kann einer Bank nicht gut bekommen und ist jedenfalls mit dem Grundsatz der Universalbank nicht in Einklang zu bringen. Eine der fatalen Folgen war, dass Firmenkunden der "Bank 24" sich Zweifeln an ihrer Bonität ausgesetzt sahen.
In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" konnten die Kunden der Deutschen Bank ein offenkundig autorisiertes Zitat des vormaligen Vorstandssprechers Rolf Breuer lesen, es sei "das standardisierte Privatkundengeschäft, das auch in unseren Geschäftszahlen das Bild trübt". Was sagen Sie dazu?
Ich glaube nicht, dass es hilfreich für eine Bank ist, wenn sie einem wichtigen Teil ihrer Kundschaft das Gefühl vermittelt, primär als Kostenverursacher betrachtet zu werden. Herr Breuer hat ja auch selbst hinzugefügt, dass man den Kunden eben nicht sagen kann, man wolle zwar gern das Anlagengeschäft mit ihnen machen, ihnen aber nicht mehr das Konto führen. Das ist sicher eine zutreffende Einschätzung der Situation.
Wie soll die Deutsche Bank nach Ihrer Auffassung dem Zwang zur Innovation und zur Anpassung an den stürmischen weltweiten Strukturwandel Rechnung tragen? Der Handlungsbedarf ist ja wirklich nicht zu bestreiten.
Bisher wurden alle Versuche, die Bank neu aufzustellen, im Wesentlichen aus dem Verkauf ihrer Beteiligungen am deutschen Industrievermögen finanziert, das in den vorausgegangenen Jahrzehnten angesammelt wurde. Wenn dieses enorme Risikopolster veräußert sein wird, kommt der Tag der Wahrheit. Im Übrigen darf ich auf meine Eingangsfeststellung und das Zurückhaltungsgebot verweisen, das im Ruhestand befindliche ehemalige Vorstandsmitglieder im Hinblick auf Ratschläge an die Adresse ihrer Nachfolger beherzigen sollten. Gleichwohl bin ich der Auffassung, dass die mit dem Zwang zur Innovation unvermeidlich entstehenden Problemfelder besser zu beherrschen wären, wenn die Deutsche Bank sich rechtzeitig einer Strukturreform unterzogen hätte.
Nach welchem Modell?
Man hätte zum Beispiel den außerordentlich erfolgreichen Effektenbereich in eine selbstständige Struktur überführen können, um seine internationale Handlungsfähigkeit zu stärken, und dann diese Aktivitäten und die herkömmlichen Geschäftsfelder der Bank unter dem Dach einer Konzern-Holding wieder bündeln können. Nach meiner Auffassung hätte eine solche Lösung viele Probleme und Irritationen vermieden.
Auch über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist nach meiner Auffassung neu nachzudenken. Heute sitzen noch zwei Mitglieder im Präsidium, die als aktive Vorstandsmitglieder an der großen Umgestaltung der Bank beteiligt waren und deshalb auch über eigene Beiträge kritisch nachzudenken haben. Die eherne Regel - nicht nur in der Deutschen Bank - den Vorstandssprecher stets nach der Pensionierung mit dem Vorsitz im Aufsichtsrat zu betrauen, garantiert zwar hohe Sachkompetenz, doch nicht zugleich die unerlässliche neutrale Distanz und Kontrolle.
In der Deutschen Bank hat sich aber offenkundig noch mehr verändert als das, worüber wir bisher gesprochen haben. Ihr früherer Vorstandskollege F. Wilhelm Christians hat öffentlich zu Protokoll gegeben, die "Bank von früher" gebe es "leider nicht mehr", und in der Deutschen Bank von heute "mit all den Einzelkämpfern" würde er die Aufgabe des Vorstandssprechers, der er ja war, nicht übernehmen wollen. Da muss es einen gravierenden Wandel im Selbstverständnis des Managements gegeben haben.
Ich möchte die Bewertungen meines geschätzten Kollegen Christians hier nicht kommentieren und mich auf die Feststellung beschränken, dass ich die Kollegialität im Vorstand, wie ich sie zwei Jahrzehnte hindurch erfahren habe, stets als nicht nur wohltuend, sondern als eine ganz unverzichtbare Voraussetzung für die Qualität der Vorstandsarbeit empfunden habe. Diese Kollegialität beruhte auf Gleichberechtigung und gleichen Bezügen. Natürlich gab es auch harte Diskussionen. Aber die Loyalität und die Kollegialität waren stets stärker als widerstreitende Interessen. Es wurde niemand majorisiert. Einstimmigkeit war stets die Voraussetzung für Entscheidungen, die ja von allen zu tragen waren.
Der neue Vorstandssprecher Josef Ackermann hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bank aus Anlass seines Amtsantritts aufgefordert, "eine Bank und ein Team zu werden". Also besteht ein solcher Zustand derzeit nicht. Weshalb nicht?
Dieser Appell ist die logische und verständliche Folge von Konflikten, die in den letzten Jahren entstanden und nicht beigelegt und bereinigt worden sind. Auch die Folgen einer durchaus neuen Vergütungsstruktur muss man sehr realistisch sehen. Der neue Vorstandssprecher ist im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die faktisch von den Vorstandsmitgliedern gewählt wurden, Vorstandsvorsitzender und wird vom Aufsichtsrat berufen. Das ist eine ganz andere Situation. Er steht im Hinblick auf das innere Gefüge der Deutschen Bank vor einer Aufgabe, für die ich ihm eine glückliche Hand wünsche, um die ich ihn aber nicht beneide.